Wider die studentische Normalität
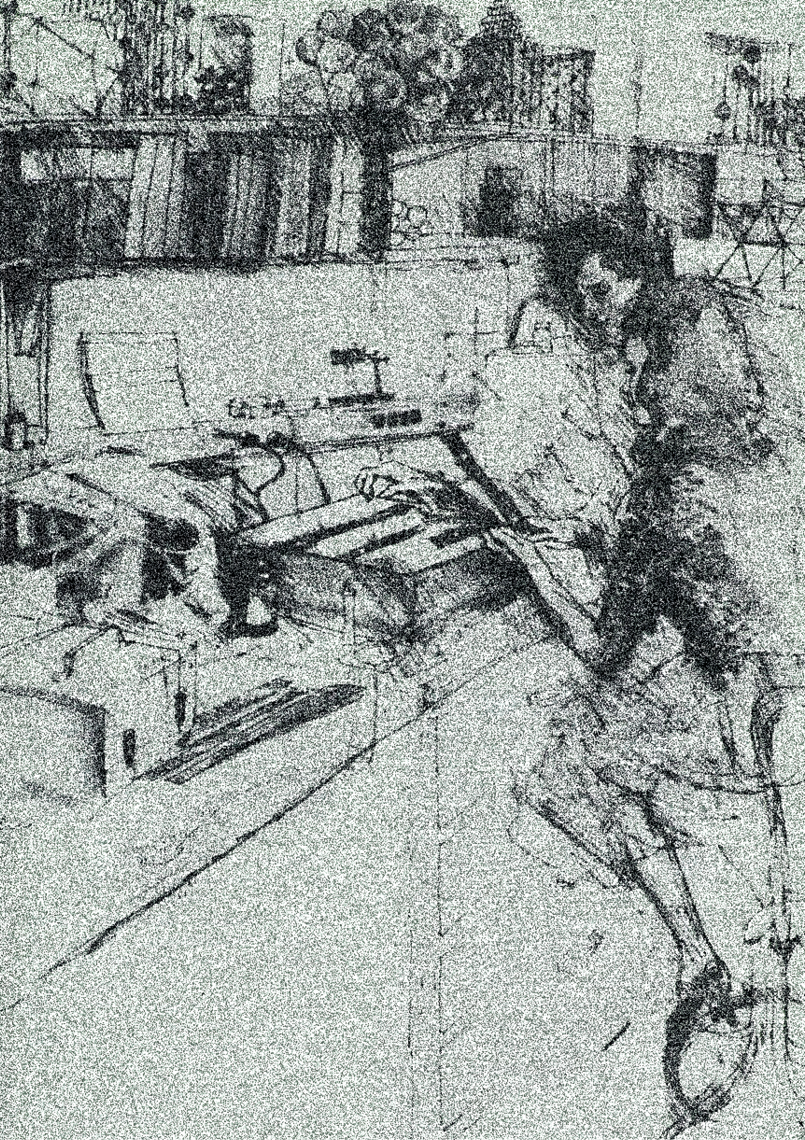
Wer – wie ich – als Kind einer Angestelltenfamilie ohne Erfahrungen mit dem tertiären Bildungssektor an die Universität kommt, wird seine naiven Vorstellungen darüber schnell enttäuscht finden. Das Bild der Akademie als Residuum des Schönen, Wahren und Guten, das ich mir nach einer von Unlust und Desinteresse geprägten und nicht ganz so erfolgreich abgeschlossenen Schulzeit ausmalte, erweist sich zunehmend als Trug.
Mir scheint, als würden die abgehangenen humanistischen Ideale an der neoliberalen Universität allenfalls noch mitgeschliffen,
um dem, was sich dort abspielt, seine Würde zu verleihen. Irritiert bin ich darüber, wie sich die Menschen dort verhalten und zu welchen Figuren sie werden.
Das Erziehungs- und Bildungswesen erfüllte schon immer die Funktion, nachwachsende Generationen in die Gesellschaft zu integrieren, mithin zum großen Teil die Reproduktion der Arbeitskräfte und der Produktionsverhältnisse zu leisten. Mal mehr mal weniger fröhlich und reibungslos tun die Zöglinge bei den Initiationsriten mit, wandert Herrschaft in Form von Selbstführungstechniken in sie ein. Ihr Formations- und Deformationsprozess setzt sich unweigerlich auch nach der Immatrikulation fort. Die Studierenden, die sich als junge Erwachsene unabhängig und widerspenstig zu fühlen beginnen, in der Realität aber allzu oft von familiärer und sozialstaatlicher Fürsorge abhängen oder sich ihre Lebensmittel schlicht durch Lohnarbeit verdienen müssen, bilden sich nach dem je von ihnen und für sie vorgesehenen Platz in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ideologisch und praktisch, habituell und charakterlich. Demnach lassen sie sich benennen.
Mittelmäßigkeit und Konformismus – Die Normies
Die wohl am häufigsten anzutreffenden Studierenden sind Normies. Normies sehnen sich in erster Linie nach Ruhe und privatem Erfolg. Daher betrachten sie ihr Studierendendasein als Durchgangsstadium, das sie für gut bezahlte Jobs qualifizieren soll. Sie können freundlich und unfreundlich daherkommen, je nachdem, wie es ihr Wunsch nach reibungslosem Durchkommen gerade verlangt. Anecken wollen sie aber eigentlich nie, sind meistens eher umgängliche Gestalten. Ähnlich wie mit ihrer Freundlichkeit verhält es sich mit ihrer Kooperationsbereitschaft. Sie ist dann am höchsten, wenn es um das private Vorankommen geht. Normies organisieren mit Vorliebe Chat-Gruppen, Orientierungswochen und Semesterfeiern, die für die Vernetzung und das Bestehen an der Uni unerlässlich sind. Gleichwohl die so gestifteten Beziehungen den Beigeschmack der Oberflächlichkeit und Hinfälligkeit an sich haben, verwirklicht sich in ihrer Offenheit und Niedrigschwelligkeit auch Zwangloses.
Weil Normies das Studentendasein so schnell wie möglich hinter sich lassen-, einfach weiterkommen wollen, stellen sie – nicht nur zu Beginn jedes Semesters – unermüdlich Fragen nach Prüfungsbedingungen, Anwesenheitsregelungen, Lernmaterialien, formalen Spitzfindigkeiten und dergleichen mehr. Es verwundert daher nicht, dass sie zu den inhaltlichen Aspekten der universitären Veranstaltung ein schlichtes aber ehrliches Verhältnis pflegen. In ihrer Unbekümmertheit erhalten sich Normies aber immerhin noch die Fähigkeit zum unbefangenen Genuss, sei es der seichtesten Kulturprodukte. Das schlägt sich später auch in der kleinbürgerlich-privativen Existenzform nieder, zu der die Normies schon während des Studiums neigen.
Normies haben ein Faible für Massenkultur, der Deviantes und Individualistisches immer schon suspekt erschien.
Mitunter wird alles, was nicht genauso durchschnittlich daherkommt, wie es die Normies in weiten Teilen selbst sind, mit Verachtung gestraft.
Wenn Normies denken, dass es besser als es grade nun mal ist nicht wird, hat das auch ein Moment der Entsagung vom Traum des vollumfänglich verwirklichten Glücks – mindestens desjenigen der Anderen – an sich. An der Universität läuft das Interesse der Normies, die die beinah beliebig disponiblen Arbeitskräfte von morgen sind, auf inhaltlich gleichgültigen Kompetenzerwerb hinaus. Dieser bleibt isoliert von materialer Bildung zwar bedeutungslos, lässt die Normies im Gegensatz zu anderen typischen Studierenden aber auch nicht zu den engstirnigsten und unangenehmsten Zeitgenoss_Innen werden. Im Fokus der Normies auf den Kompetenzerwerb liegt auch ihre Tendenz zur politischen Indifferenz begründet, die letztlich auf die Verewigung des nun einmal Seienden hinausläuft. Weniger geht das aus schlechtem Vorsatz, denn aus Unkenntnis der die Normies umgebenden Verhältnisse sowie vermeintlicher Wertneutralität ihnen gegenüber hervor. Beides wird von der positivistischen Wissenschaft, die im Grunde genommen nur technisch-praktische Fähigkeiten lehrt als letzter Schuss der Weisheit sanktioniert. Zu ihr werden die Normies gedrängt, fühlen sich aufgrund ihrer Bedürfnisstruktur aber auch davon angezogen.
Klugschwätzigkeit und Opportunismus – Die Karrierist_Innen
Wovon Normies als Studierende weitgehend unangetastet bleiben, ist das, woran man Karrierist_Innen am häufigsten erkennen kann: ihre professionelle Deformation schon während des Studiums. Sie machen ihre Funktion innerhalb der universitären Maschine zu ihrer ganzen Identität und perfektionieren damit den Verkauf ihrer Ware intellektueller Arbeitskraft. Wen verwundert es da, dass von den Aufstiegsaspirant_Innen kaum eine Gelegenheit ausgelassen wird, um die vermeintliche Liebe zur Wissenschaft, die in den meisten Fällen nur Fachidiotie ist, zur Schau zu stellen? Für Karriereorientierte ist diese Inszenierung das Mittel der Wahl um sich inner- und außerakademisch einen Namen zu machen. Die Angepasstheit der Normies übertrumpfen sie noch durch ihre besondere Wortgewandtheit und Beflissenheit.
Wahrhaftiges Bildungsinteresse, das sich bei ihnen nicht bloß vordergründig gegenüber dem nach einer prosperierenden Privatexistenz durchsetzt, wird schnell kassiert, wenn sich die Aussicht auf eine Anstellung – gleichgültig ob im universitären oder außeruniversitären Apparat – ergibt. In der Anbiederung ans Mächtigere sind die wissenschaftlichen und politischen Anschauungen im Grunde genommen beliebig, jedenfalls nicht wirklich umwälzend, denn geschielt wird auf die bestmögliche Position im Status quo, keineswegs aufs ganz Andere. Die Bildung der Karrierist_Innen wird zur Halbbildung, wenn sie sich den Gegenständen nicht mehr widmen, sondern sie instrumentell aneignen und verarbeiten.
Wer auf die Karriere bedacht ist, arbeitet mit Vorliebe als studentische Hilfskraft oder in den Gremien der studentischen Selbstverwaltung.
Die Teilnahme am universitären Zeremoniell fingiert Wichtigkeit und Souveränität
und wirkt auf Karrierist_Innen deshalb merkwürdig berauschend. Hier kann man sich außerdem besonders gut vernetzen und für die Laufbahn relevantes soziales und kulturelles Kapital akkumulieren. Darüber hinaus strahlt schon etwas von der schalen Aura einer akademischen Anstellung auf diese Stellen aus und die ganz Engagierten können in Tutorien und Mentoringprogrammen vor minder bemitteltem Publikum glänzen. Zwar wird hier gelegentlich wirklich die Isolation und Einsamkeit unter den Studierenden gebrochen, öffentliches Sprechen gelernt und Triftiges vermittelt, mithin zu Vernunftgebrauch und Verstandestätigkeit ermutigt. Gleichzeitig stehen die Hiwis und Gremienfuzzis aber immer auch in einem fast schon parasitären Abhängigkeitsverhältnis zur Institution, sind Agenten des Betriebs und erledigen vorwiegend die schäbigen Aufgaben der Prüfungsvorbereitung und Informationsübermittlung in alle Richtungen. Als Ausgleich dafür ziehen sie immerhin noch ihren Lebensunterhalt aus dem System und können sich darin profilieren.
So wichtig wie solche Typen damit für die Universität sind, so wichtig ist die Arbeit an der Universität für sie selbst, denn sie eignen sich dabei die für ihre spätere Laufbahn in den höheren Angestellten- und Führungspositionen obligatorischen Softskills an. Wer etwas vom Lehren und Moderieren versteht, in der Diskussion – sei es aus sachlichen, sei es aus unsachlichen Gründen – Anderen auch mal über den Mund fahren-, sich zu viel Arbeit und Mühe für zu wenig Geld geben kann und nebenbei sogar noch Zertifikate erwirbt, hat‘s später, im Berufsleben, eben einfach leichter. Ohnehin sind die Sublimierungsleistungen der Karrierist_Innen beachtlich, selbst wenn derartige Charaktere manchmal so aalglatt daherkommen, dass sie sich schon den Spitznamen „Teflon“ eingefangen haben sollen.
Integrierte Subversivität – Die Wokies
Anders als bei den Normies und Karrierist_Innen ist für Wokies in erster Linie die Weltanschauung identitätsstiftend. Gleichzeitig stiftet Identität den zentralen Bezugspunkt der Weltanschauung. Die Ablehnung des Systems gilt für sie als selbstverständlich. Das aber bedingt ihren sonderbaren Konformismus, dem ironischerweise jede sachliche Differenz zu den eigenen Wahrnehmungs- und Denkschemata anrüchig erscheint. Populär gewordene poststrukturalistische Philosophie frisst ihre Kinder. Die von Gänsefüßchen, Abkürzungen und Sternchen orchestrierte Rede der als Wokies Gelesenen über „Andere“, PoC, LGBTQ* und FLINT* ist wenig mehr als die sprachakrobatische Aufnahmeprüfung in die gute Gesellschaft der Linksliberalen. Insbesondere an der Universität.
Der Habitus der Wokies ist eng verknüpft mit pathetischer Zurschaustellung und Anerkennung von Diskriminierungserfahrungen, deren Omnipräsenz und Gefährlichkeit zu leugnen reaktionär ist. Beim von den Wokies betriebenen virtue signaling aber löst emotionale Bewegung die des Begriffs tendenziell ab. Mit dem Hang zu Sentimentalität und Empörung geht allzu häufig ein laxer Umgang mit Theorie einher, die nicht selten zum bloßen Objekt von Projektion verkommt. Wokies sind schlimmstenfalls umgekehrte Halbgebildete, die sich mit einem Zeitgeist affektiv überidentifizieren, den sie nicht so recht durchdrungen haben. Ihr Weltbild ist teils manichäisch und von Personalisierungen durchsetzt, wird fundamentalistisch wo es absolut setzt, was immer neu zu prüfen wäre: das einmal gefällte Urteil. Wer jemals in Verdacht gerät, zu den Bösen zu gehören, kann im Handumdrehen von der Glaubensgemeinschaft der Woken exkommuniziert werden. Der gute Wille, Benachteiligung aufgrund von angenommener oder wirklicher Zugehörigkeit zu race, class oder gender aufzuheben, wird zum Vehikel der Segregation vom Pöbel, wenn er sich mit symbolischen Repräsentationskämpfen bescheidet, die allemal ihr Recht haben mögen.

Das genuine Bedürfnis, dem Besonderen gegenüber der erdrückenden Übermacht des Allgemeinen theoretisch und praktisch zu seinem Gedeih zu verhelfen, schlägt um in die mitunter reflexartig skeptizistische und romantizistische Ablehnung jedes Ordnungsmoments. Wer kann es den Wokies auch verübeln, wird heute doch mehr denn je alles, was anders ist oder sein will kulturindustriell zurechtgestutzt und in die totalitäre Realabstraktion der Warenform gepresst. Selbst in den hinterletzten Ecken der abgesonderten Pseudowelt des Online- und Meme-Spektakels, zu der die Wokies eine besondere Affinität haben, lässt sich diese Tendenz ausmachen.
Der sympathische Impuls zum Degout gegenüber allem Verbindlichen und Verbindenden zeitigt bei Wokies des Öfteren einen dogmatisch anmutenden, vulgären Relativismus, dem zuletzt alles beliebig wird. Im Endeffekt erscheint noch das Denken als einzustellende Unmöglichkeit und weicht konsequenterweise der willkürlich-fluiden Assoziation die sie sich im weitgehend sinnbefreiten Gestotter manch eines woken Sprechautomaten bestaunen lässt. Die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise lässt sich so natürlich nicht mehr antizipieren und was als Subversives in die Welt kam wird zum Moment der Verewigung des schlechthin Bestehenden.
Schließlich gibt es für Wokies überhaupt keine Idee einer Gattung mehr, die ihre Geschichte bewusst selbst in die Hand nehmen könnte
– sie ist verschwunden wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand – nur noch isoliert voneinander existierende Partikularitäten die in einem unendlichen Streit um Anerkennung und Hegemonie stehen.
Werden Universalismus und Kritik der politischen Ökonomie von Wokies also auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt, wird folgerichtig affirmiert, was dem Selbstverständnis nach abgelehnt werden sollte: das System. Des neoliberalen Kapitalismus nämlich. Es zu erkennen schicken sich die Woken ohnehin nicht mehr an. Sie reichen damit Ideologen wie Hayek die Hand, nach dessen Diktum man das auch überhaupt nicht kann. Der neuste Geist des Kapitalismus vermag es denn auch, sich das als revolutionär Gedachte einzuverleiben. In den gegenwärtigen globalisierten Produktionsverhältnissen kann es sich kein Unternehmen von Rang noch leisten, auf eine Diversity-, Corporate-Social-Resonsibility-, oder Sustainabilityabteilung zu verzichten. Auch deshalb tröpfelt der woke Lifestyle langsam zu den Normies und Karrierist_Innen durch, die ihn als zeitgenössische Bedingung der profitablen Verwertung der eigenen Arbeitskraft erahnen und zu adaptieren wissen. Die Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und ein verächtliches Wesen ist, werden so allerdings nicht abgeschafft-, sondern von neuen, besseren Menschen fortgeführt. Dem entsprechen dann auch die Positionen, die Wokies im ökonomischen und staatlichen Apparat nach ihrem Studienabschluss besetzen.
Intellektualistische Borniertheit – Die Theoriemacker
Über allen anderen Typen erhaben fühlen sich die Theoriemacker. Das Maskulinum ist hier nicht nur generisch bedingt, wenngleich Ausnahmen vorkommen mögen. Mit aufgepumpten Theoriephallus versuchen sie ihre lebensweltliche und politische Impotenz zu kompensieren. Die Allgemeinbildung, die sie sich zueignen, wird in der Postmoderne allerdings tendenziell nutzlos. Niemand weiß mehr so recht etwas mit ihr anzufangen, nicht einmal die Theoriemacker selbst. Sie ziehen sich deshalb in quasi esoterische Szenebubbles oder gar – allzu deutsch – in die völlige Innerlichkeit zurück, entsagen der Realität und vergessen durch ihre nicht selten abstrakte Negation des Status quo die Möglichkeiten der Freiheitsverwirklichung, die dieser auch für sie bereithalten könnte.
Die kritischsten aller Kritiker_Innen wissen, dass das, was nach der Uni kommt nicht freier und besser, sondern noch lustloser und dröger wird.
Auf der Flucht in theoretische und institutionelle Nischen idealisieren sie ihre studentische Nichtigkeit, um wenigstens die eigenen narzisstischen Bedürfnisse befriedigen zu können. In ihrem Hang zu antiquierten Theorien wie der Kritischen zeigt sich abermals ihre Neigung zum Illusorischen. Im Zeitalter des kapitalistischen Realismus, in dem es einfacher ist, sich das Ende der Welt als das Ende ihrer aktuellen Produktionsweise vorzustellen, verzichten sie – ihren Päpsten Adorno und Horkheimer hörig – auf das ausmalen einer konkreten Utopie und finden dadurch weder ein noch aus. Auch das macht sie in einer von Produktivität und Positivität besessenen Gesellschaft, die auf ihrer Schattenseite massenhaft die zur Volkskrankheit erklärte Depression ausbrütet, zu den beschränkten Eigenbrötlern, die sie nun einmal sind.
Bei allem pseudointellektuellen Gebaren wird der geistige und praktische Infantilitätszustand trotzig-provokativer Knirpse, die nicht mitmachen wollen, weil ihre schönsten Wünsche und Träume einfach nicht eingelöst werden, nie so ganz überwunden. Zum Charakterzug gewordene Kränkung und Verbitterung-, mithin Ressentimentbeladenheit sind deshalb Merkmale, an denen man viele Theoriemacker zielsicher bestimmen kann. Ihre Verbalradikalität ist davon nur ein weiterer Ausweis. Sie prägen sich zwar das Grauen ein, mit dem sie sich ständig konfrontiert sehen, verzichten traurigerweise aber allzu häufig auf den praktischen Eingriff in es. Theorienerds stehen den Idioten, die sie so sehr verachten, näher als es ihnen lieb ist, wenn ihre Kritik zum privatistischen Hobby verkommt. Durch die Enttäuschung ihrer Bedürfnisse geraten sie zur Identifikation mit dem, was ihre Befriedigung verhindert, regredieren oder werden aggressiv sich selbst und anderen gegenüber. Ihre avantgardistische Performance ist nur eine andere Form des engstirnigen Provinzialismus der sich nicht wirklich von einmal liebgewonnen Auffassungen und Zuständen emanzipieren mag. Trotz der Kritik, die Theoriemacker oberflächlich an Provinzialismus und Partikularismus hervorbringen, wirkt beides auf sie seltsam begehrlich.
Theoriemacker sind Edgelords, die so kantig sind, dass sie sich an sich selbst stoßen. Grund genug dazu haben sie. Denn im Laufe der Zeit kommt ihnen allmählich jede Spontanität und Genussfähigkeit abhanden. Der Umgang mit ihnen ist unerfreulich. Sie finden aus ihrer permanent vollbrachten Verkopfung des Blicks auf alles und alle kein Zurück mehr. Noch durch ihre verstockt hochgestochene Sprache wollen sie sich als nicht Dazugehörige ausweisen und Exklusivität simulieren. Fällt ihnen das auf, drängt es sie zum anderen Extrem: der Jovialität. Das wohlwollend-herablassende Verhalten sich selbst und anderen gegenüber, ist jedoch wiederum auf seine Art entwürdigend. Denn der bewusste und unbewusste Verzicht auf die Realisierung eines einmal erworbenen Anspruchs wird immer um den Preis einer Lüge erkauft. Man sagt nicht alles, was empfunden und gedacht wurde-, erduldet, was nicht zu erdulden ist. Gezwungenermaßen verstellen sich Theoriemacker – wie alle anderen auch – um wenigstens noch in Teilen den Schein von Harmonie und Zufriedenheit zu wahren. Nicht nur von den äußeren Verhältnissen sind sie also gestört, sondern auch von den inneren.
Es heißt, die Wahrheit mache frei. Für Theoriemacker gilt das nicht. Denn die Art von Reflexionsfähigkeit und Mündigkeit, die sie sich durch ihr unnachgiebiges Streben erwerben, wirkt vergeblich. Unter den Studierenden dürften sie die unglücklichsten sein. Jede Perspektive die sich ihnen bietet erscheint ihnen in ihrer zur Absolutheit erhobenen Negativität als falsche. An der Desillusionierung ihrer Hoffnungen können sie nur noch resignieren.
Wider die studentische Normalität
Trotz aller Ohnmacht, mit der radikale Kritik heute geschlagen ist, gilt es, doch nicht von ihr abzulassen. Sie allein vermag es, die Potentiale richtiger wie falscher Theorie und Praxis aufzuzeigen, die auch und vor allem an der Universität ausgebrütet werden.
Die Vergegen-ständlichung studentischer Idealtypen lässt es zu, sich selbst in ihnen wiederzuentdecken.
Durch die Projektion von als verwerflich angenommenen Persönlichkeitsanteilen und Ideologiefragmenten aufs Klischee will Irritation und Anstoß erregt werden. Die Aufhebung von Zuständen, die allemal unbefriedigt lassen, soll dadurch mitvorbereitet werden. Nur wer sie auf die Erkenntnis seiner selbst und aller Anderen in ihrem Gewordensein einlässt, vermag es, subjektive und objektive Deformationen und Zwangsmechanismen zu bewältigen.
Letztlich beschreibt jeder Typus ein für mich als überwunden geglaubtes Stadium meiner eigenen Entwicklung. Obwohl ich es teilweise möchte, kann ich diesen Stadien doch nicht entfliehen und werde immer auf sie verwiesen bleiben. Zu wissen, wer ich bin oder sein will, fällt mir schwerer denn je. Zu wissen, wer ich nicht sein will, dafür umso leichter. Studentische Subjektivität glückt heute normalerweise nicht mehr. Aber sie solls!
