Notizen zu Selbsterhaltung und Triebleben

Der vorliegende Text, der einen leicht modifizierten Ausschnitt aus einer längeren Arbeit zu Psychoanalyse und Subjektkonstitution darstellt, befasst sich mit der von Freud bemerkten wesentlichen Differenz von Instinkt und Trieb, der Frage nach der Genese des letzteren aus der instinktbasierten Selbsterhaltungslogik des biologischen Lebens und damit letztlich mit dem Prozess der genuinen Menschwerdung im Ganzen, d. i. der Geburt von Subjektivität und Freiheit im menschlichen Geist, der zunächst ein tierischer Geist ist. Die Emanzipation des menschlichen Trieblebens geht mit der Entstehung eines radikal neuen Verhältnisses zu den Objekten der Umwelt einher, die nun auf der Grundlage ihres Potenzials, Lust zu bringen, und nur noch sekundär wegen ihrer unmittelbar nutzbringenden Eigenschaften Gegenstände des Interesses werden. Das Spiel, als eine den Objekten – zu denen, als eine Untergruppe, auch die anderen Subjekte gehören – zugewandte Praxis der Lustgewinnung, ist nicht denkbar ohne die Freiheit der Objektwahl, die den Trieb kennzeichnet. Wie aber können wir uns den Vorgang verständlich machen, der das Tier Mensch in dieser Weise zu einem Lustsucher transformiert?
Die Funktion der Selbsterhaltung ist es, jene Objekte aufzusuchen, die der Organismus benötigt, um seine Homöostase aufrechtzuerhalten und jene zu meiden, die ihn mit Unordnung, d. h. im Grenzfall: mit dem eigenen Tod bedrohen. Zu diesem Zweck verbindet sie Reize mit Motilitätsschemata – Aufsuchen, Fliehen, Beißen usw. Die Verbindung von Reiz und Reaktionsschema ist aber keine unmittelbare; sie setzt voraus, dass der Reiz für das Gesamtobjekt bzw. dessen gesuchtes Attribut einsteht oder es repräsentiert. Etwas anderes zu repräsentieren gehört jedoch nicht zu den natürlichen Eigenschaften von Objekten, setzt daher voraus, dass ein Anderes die synthetische Operation – ‚dieser Reiz für dieses Objekt/Attribut’ – vollzieht. Der Organismus selbst muss also eine Art Proto-Repräsentation des Reizes enthalten, dessen Übereinstimmung mit der realen Reiz-Wahrnehmung den Anstoß liefert, den Organismus in Bewegung zu setzen.1 Der Bestand an solchen ‚Repräsentationen’ bildet das, was Uexküll die „Merkwelt“ des Organismus nennt: jene Auswahl an Reizen, die das Lebewesen seiner natürlichen Ausstattung nach aufzunehmen und mit seinem Instinktrepertoire zu verbinden vermag, um Wirkungen hervorzubringen.2 Was wir hier zunächst vor uns haben, ist also eine Welt biologischer Automaten: alles spielt sich ab wie bei einem Algorithmus, der mechanisch Objekte abtastet und auf ihre Passung zu seinem abstrakten Programmschema testet. Es könnte daher der Einwand erhoben werden, dass von dieser ‚toten‘ Welt aus kein denkbarer Weg hin zu der Innenwelt des Subjekts führt, die wir suchen – die Automaten, die gewissermaßen ‚philosophische Zombies‘ im Sinne des bekannten Gedankenexperiments darstellen, benötigen eine solche nicht, ihr Verhalten ist auf der Basis biochemischer Prozesse vollständig erklärbar. Etwas muss die Harmonie von Organismus und Objekt, Reiz und Reaktion aufbrechen, wenn aus dem stillen Determinismus materieller Prozesse die Triebwelt des Subjekts entstehen soll.
« Etwas muss die Harmonie von Organismus und Objekt, Reiz und Reaktion aufbrechen, wenn aus dem stillen Determinismus materieller Prozesse die Triebwelt des Subjekts entstehen soll. »
Vonseiten des Organismus selbst spricht nichts Prinzipielles gegen die obige Beschreibung: das Merken, die Erkennung des Reizes als eines Objektrepräsentanten setzt voraus, dass das Objekt im Merkschema auf das Wesentliche, d. i. auf das für den Organismus Relevante reduziert ist. Die Repräsentation hat also den Charakter eines Idealtyps, ganz so, wie auch ein Algorithmus seine Objekte nur als ‚Definitionen’ kennt und über die An- oder Abwesenheit abstrakter Definitionsmerkmale aus ihnen die passenden heraussucht. Nun ist aber die technisch-mathematische Welt der Algorithmen eben wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass ‚Akteur’ und Objekt identischer Natur sind: bei beiden handelt es sich um abstrakte Objekte, die sich vollständig als Bündel ebenso abstrakter Einzelelemente beschreiben lassen. Die Welt der natürlichen Objekte, mit denen sich der Organismus konfrontiert sieht, erfüllt diese Anforderungen jedoch nicht, wie es Nietzsche eindrücklich betont hat:
Denken wir besonders noch an die Bildung der Begriffe: jedes Wort wird sofort dadurch Begriff, dass es eben nicht für das einmalige ganz und gar individualisirte Urerlebniss, dem es sein Entstehen verdankt, etwa als Erinnerung dienen soll, sondern zugleich für zahllose, mehr oder weniger ähnliche, d.h. streng genommen niemals gleiche, also auf lauter ungleiche Fälle passen muss. Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des Nicht-Gleichen. So gewiss nie ein Blatt einem anderen ganz gleich ist, so gewiss ist der Begriff Blatt durch beliebiges Fallenlassen dieser individuellen Verschiedenheiten, durch ein Vergessen des Unterscheidenden gebildet und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur ausser den Blättern etwas gäbe, das „Blatt“ wäre, etwa eine Urform, nach der alle Blätter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, gefärbt, gekräuselt, bemalt wären, aber von ungeschickten Händen, so dass kein Exemplar correkt und zuverlässig als treues Abbild der Urform ausgefallen wäre.3
An diesem Punkt ist in entscheidender Weise die Beziehung zwischen instinktiven Verhaltensschemata und äußeren Objekten gestört. Sobald wir uns von den einfachsten Organismen wegbewegen, deren Verhalten ohne großen Sinnverlust als ‚Tropismus’ beschrieben werden kann – bspw. ein Cyanobakterium, das sich an die für es ideale Position innerhalb eines Lichtintensitätsgradienten bewegt und dafür nur eines simplen chemischen Mechanismus bedarf, der auf das Sonnenlicht reagiert –, entspinnt sich eine Dialektik von Identität und Nichtidentität, die die Selbsterhaltungsfunktionen stetig und in notwendiger Weise, d. i. unabstellbar, destabilisiert. Je primitiver und abstrakter die Repräsentation des äußeren Objekts, desto größer die Gefahr der Fehlleistung;4 je weiter sich das Lebewesen in Richtung der Fähigkeit zur Korrelation und Interpretation mannigfaltiger Eindrücke bewegt, desto länger ist die Phase der Hilflosigkeit, in der seine Intelligenz lernen muss, den Mangel an instinktiven Verhaltensschemata zu kompensieren.
« …je weiter sich das Lebewesen in Richtung der Fähigkeit zur Korrelation und Interpretation mannigfaltiger Eindrücke bewegt, desto länger ist die Phase der Hilflosigkeit, in der seine Intelligenz lernen muss, den Mangel an instinktiven Verhaltensschemata zu kompensieren. »
Die größere Öffnung hin zum Gegenstand geht also mit einem Selbstverlust einher, der das Lebewesen wiederum der größten Gefahr aussetzt, wie es die Hilflosigkeit des menschlichen Kindes am deutlichsten zeigt. Es ist diese wechselseitige Insuffizienz von Selbsterhaltung und Objekt, die sowohl auf der phylogenetischen Ebene, die wir gerade betrachtet haben, als auch auf der ontogenetischen, der wir uns nun widmen wollen, den Bewegungsimpuls liefert, der die Entwicklungsprozesse hin zu Intelligenz und Subjektivität antreibt. Die tote Welt der Selbsterhaltung, die wir zu Beginn gesetzt haben, stellt sich heraus als eine wesentlich von Entwicklung und Abweichung geprägte, aus der das Leben als der immanente Differenzierungsprozess entlang der Bruchlinie von Identitätsforderung des Lebewesens und Nichtidentität des Objekts nicht wegzudenken ist. Die alte epikureische Theorie, nach der es die unvorhersehbare Abweichung der Materie von ihrer deterministischen Bahn sei, die verantwortlich für die Entstehung komplexer Formen und Strukturen ist, bewahrheitet sich hier auf der höheren Ebene der Entwicklung lebendiger Systeme.5 Wie aber stellt sich vor diesem Hintergrund die besondere Situation des Menschen dar?
Der Mensch weist unter allen Lebewesen die höchstentwickelte Intelligenz, damit aber nach der gerade von uns identifizierten Dialektik auch den größten Mangel an Instinktsicherheit auf. Es geht ihm, wiederum mit Nietzsche gesprochen, nicht
anders als es den Wasserthieren ergangen sein muss, als sie gezwungen wurden, entweder Landthiere zu werden oder zu Grunde zu gehen […] - mit Einem Male waren alle ihre Instinkte entwerthet und „ausgehängt“. Sie sollten nunmehr auf den Füssen gehn und „sich selber tragen“, wo sie bisher vom Wasser getragen wurden: eine entsetzliche Schwere lag auf ihnen. Zu den einfachsten Verrichtungen fühlten sie sich ungelenk, sie hatten für diese neue unbekannte Welt ihre alten Führer nicht mehr, die regulirenden unbewusst-sicherführenden Triebe, — sie waren auf Denken, Schliessen, Berechnen, Combiniren von Ursachen und Wirkungen reduzirt, diese Unglücklichen, auf ihr „Bewusstsein“, auf ihr ärmlichstes und fehlgreifendstes Organ!6
Für die Selbsterhaltung des Individuums bedeutet diese Situation, dass ihre Verbindung zum Objekt im äußersten Maße unterbestimmt und kontingent ist: Alles muss gelernt werden, nichts ist selbstverständlich, am wenigsten die ‚Wahl’ der Objekte, die dem Kind zum größten Teil von außen und nach Maßgabe variabler, sich untereinander widersprechender gesellschaftlich-kultureller Logiken oktroyiert werden.
« Für die Selbsterhaltung des Individuums bedeutet diese Situation, dass ihre Verbindung zum Objekt im äußersten Maße unterbestimmt und kontingent ist: Alles muss gelernt werden, nichts ist selbstverständlich, am wenigsten die ‚Wahl’ der Objekte, die dem Kind zum größten Teil von außen und nach Maßgabe variabler, sich untereinander widersprechender gesellschaftlich-kultureller Logiken oktroyiert werden. »
Die anarchische Logik, die hier statthat, beschreiben Deleuze und Guattari treffend; der Mensch, auf den wir hier treffen, ist nicht die „Krone der Schöpfung”, sondern „jener von allen Formen und Ausprägungen des Lebens ergriffene Mensch, dem selbst Sterne und Tiere zur Bürde aufgegeben sind und der nie aufhören wird, eine Organmaschine an eine Energiemaschine anzuschließen, oder einen Baum in seinen Körper, eine Brust in den Mund, die Sonne in den Hintern einzuführen, ewiger Verwalter der Maschinen des Universums.”7 Die menschlichen ‚Organmaschinen’ bilden „binäre, auf binärer Regel und assoziativer Ordnung beruhende”8 Maschinenkopplungen, d. i. relativ konstante Verknüpfungen mit (Partial-)Objekten: der Mund bindet sich an die Brust (oder die Flasche, oder den Schnuller, oder…), die verschiedenen Hautregionen an das, was Wärme spendet usw. Diese basale Fähigkeit des Organs, sich an eine Vielzahl von Äquivalenten binden zu können, ist dem Menschen und anderen höheren (Säuge-)Tieren gemein, das Schicksal dieser ‚Maschinenkopplungen’ in der onto- und phylogenetischen Geschichte des Menschen aber ist einzigartig und bildet die Grundlage der Entstehung der Triebwelt.
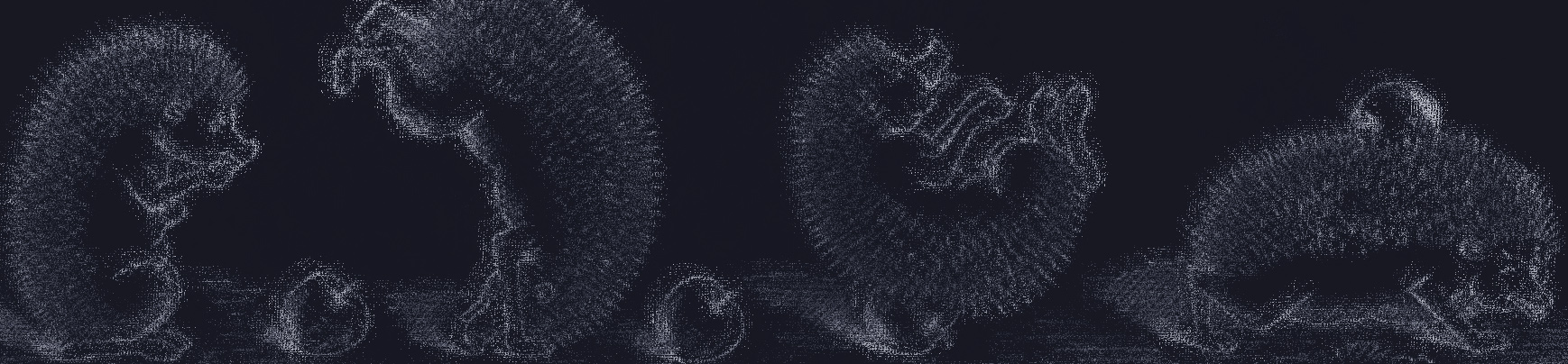
„Die Wunschmaschinen [mit diesem Begriff bezeichnen Deleuze und Guattari die universelle ‚Maschinennatur’ der Wirklichkeit; für unsere Zwecke ist es ausreichend, hier an die menschlichen Organ-’Maschinen’ zu denken, S.T.] erschaffen uns einen Organismus, doch innerhalb dieser seiner Produktion leidet der Körper darunter, auf solche Weise organisiert zu werden, keine andere oder überhaupt eine Organisation zu besitzen. […] Die Wunschmaschinen laufen nur als gestörte, indem sie fortwährend sich selbst kaputt machen.”9 Kein Organismus kann, wie wir gerade etabliert haben, ganz ohne solche ‚Störung’ laufen, und je ausgeprägter seine Intelligenz, desto problematischer der Zusammenhalt von Selbsterhaltung und Objekt. Zwischen Tier und Mensch klafft hier aber die entscheidende Lücke auf: Während bei jenem die Instinktbasis noch so stark ausgeprägt ist, dass es bei aller Indeterminiertheit der Objektbindung zu keinem Ausbruch aus den großen Bahnen des Gattungslebens kommt, erreicht die Instabilität des Prozesses bei diesem einen kritischen Punkt. „Die Automaten stehen still und lassen die unorganisierte Masse, die sie gegliedert haben, aufsteigen”10; es entsteht, was Deleuze und Guattari den ‚organlosen Körper’ nennen, den sie sogleich mit dem Freudschen Todestrieb gleichsetzen.11 Eine Masse frei flottierender, ungebundener psychischer Energie also, die sich von ihrer ehemaligen Gebundenheit an die Objekte der Selbsterhaltung frei gemacht hat12 und nach Abfuhr, d. h. nun konkret: Lust sucht.
Die scheinbar mirakulöse Natur dieses Entstehungsvorgangs lässt sich anhand analoger Prozesse, die uns aus den Naturwissenschaften bekannt sind, teilweise auflösen; so beschreiben etwa Ilya Prigogine und Isabelle Stengers die aus der Thermodynamik bekannten ‚dissipativen Strukturen‘ in bewusster Analogie zu biologischen Strukturierungsvorgängen:
We know that far from equilibrium, new types of structures may originate spontaneously. In far-from-equilibrium conditions we may have transformation from disorder, from thermal chaos, into order. New dynamic states of matter may originate, states that reflect the interaction of a given system with its surroundings. We have called these new structures dissipative structures to emphasize the constructive role of dissipative processes in their formation. […] Matter near equilibrium behaves in a ’repetitive’ way. On the other hand, far from equilibrium there appears a variety of mechanisms corresponding to the possibility of occurence of various types of dissipative structures. […] Obviously such a situation can no longer be described in terms of chaotic behavior. A new type of order has appeared. We can speak of a new coherence, of a mechanism of ’communication’ among molecules. But this type of communication can arise only in far-from-equilibrium conditions. It is quite interesting that such communication seems to be the rule in the world of biology.13
Wir nehmen uns die Bereitschaft der Autoren, den Begriff der dissipativen Struktur auf das Feld der Biologie auszuweiten, zum Vorbild und halten es für gewinnbringend, auch das Psychologische mit einzubeziehen: Der simple Organismus, der – idealtypisch gesprochen – auf reiner Instinktbasis agiert, entspricht einem System, das nah am Gleichgewicht oder ‚Equilibrium’ agiert; die Bewegung zur Intelligenz mit der ihr proportionalen Zunahme an Indeterminiertheit des Instinkts produziert eine ebenso große Zunahme an Ungleichgewicht im System; in der menschlichen Entwicklung erreicht dieses System der Selbsterhaltung einen kritischen Punkt der Instabilität, an dem das Ungleichgewicht so groß geworden ist, dass sich spontan eine neue Art von Struktur bildet, die, obwohl sie die Elemente des früheren Systems als Konstituenten enthält, einer neuen Logik folgt, die auf ihren historischen Ursprung nicht reduzibel ist. Unserer Auffassung nach handelt es sich hier um nichts anderes als die früheste Ausprägung des ’Ich’ oder um die Geburt des Subjekts aus der immanenten Instabilitätsdynamik der Selbsterhaltungsfunktion: Das Lustprinzip entsteht aus dem Untergang der Selbsterhaltung entsprechend ihrer eigenen dialektischen Entwicklung und verändert das Objekt-Verhältnis des Individuums, das wir nun anfangen dürfen, als Ich oder Subjekt mit einem Innenleben anzusprechen, grundlegend:
“Der Säugling wird sich binnen kurzer Zeit aus Liebe, und nicht aufgrund eines Überlebensinstinktes, ernähren: aus Liebe zu seinen Objekten, aus Liebe zur Mutter, aus Liebe zu seinem Ich”14 – “die Selbsterhaltung (der Instinkt) [ist], im Leben eines jeden einzelnen von uns, ‚auf die Reservebank geschickt worden […]’, disqualifiziert, genauso wie die Selbsterhaltung in der Bewegung des Freud’schen Denkens, nach 1915, zur Seite geschoben ist.”15
Halten wir an dieser Stelle inne. Die spekulative Bahn unseres Gedankens hat uns von der Annahme einer toten Welt biologischer Automaten, die durch die kritische Reflexion ihrer Vorannahmen als eine der Sache unangemessene Abstraktion verworfen werden konnte, hin zu einer dynamischen, dialektisch beschreibbaren Konfliktdynamik von Innen und Außen, Organismus und Objektwelt geführt, die zunächst die Entstehung von Intelligenz als Prüf- und Korrekturinstanz der instinktiven Objektsuche erklären und in einem weiteren Schritt den Schlüssel für die Interpretation des qualitativen Umbruchs im Objektverhältnis, der die menschliche Subjektivität im Gegensatz zur tierischen ‚Protosubjektivität‘ kennzeichnet, liefern konnte. Der Trieb als Inbegriff der vom Selbsterhaltungszwang befreiten psychischen Energie ist die entscheidende Entdeckung der Psychoanalyse, die es erlaubt, eine Theorie des menschlichen Geistes zu begründen, die weder in einen unproduktiven Dualismus von Körper und Geist, noch einen reduktiven Materialismus verfällt, sondern dazu fähig ist, die Genese des Subjekts aus dem Nicht-Subjektiven genauso nachzuvollziehen wie die Freiheit des Geistes, ohne die es keine Praxis der Veränderung der Wirklichkeit geben kann, die das Moment des utopischen Wunsches in sich behält.
Endnotes
-
Eine rein chemikalisch-deterministische Theorie biologischen Handelns scheitert daran, das Verhalten komplexer Lebewesen zu erklären, deren Interaktion mit der Umwelt nicht darauf zu reduzieren ist, sich von dieser wie eine Marionette bewegen zu lassen. Uexküll beschreibt sehr gut die Logik dieses Ansatzes für einfache, auf Licht reagierende Lebewesen: „Es sollen die Lichtstrahlen bei ihrem Durchgang durch den Tierkörper diesen zu drehen befähigt sein wie etwa ein Magnet die Eisenfeilspäne. […] Zwar erscheint es verlockend, alle Bewegungen der Tiere auf Tropismen zurückzuführen, denn das überhebt uns der Aufgabe, die scheinbar einfachen Vorgänge als Leistungen einer schwer zu ermittelnden Struktur zu behandeln. Aber eine sichere Grundlage gewinnt man nur durch das Studium der Struktur und des Bauplanes”, von Uexküll, Jakob Johann (1909): Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin: Julius Springer, S. 9. ↩
-
„Wer aber noch der Ansicht ist, daß unsere Sinnesorgane unserem Merken und unsere Bewegungsorgane unserem Wirken dienen, wird auch in den Tieren nicht bloß ein maschinelles Gefüge sehen, sondern auch den Maschinisten entdecken, der in die Organe ebenso eingebaut ist wie wir selbst in unseren Körper. Dann wird er aber die Tiere nicht mehr als bloße Objekte, sondern als Subjekte ansprechen, deren wesentliche Tätigkeit im Merken und Wirken besteht. Damit ist aber bereits das Tor erschlossen, da zu den Umwelten führt, denn alles, was ein Subjekt merkt, wird zu seiner Merkwelt, und alles, was es wirkt, zu seiner Wirkwelt. Merkwelt und Wirkwelt bilden gemeinsam eine geschlossene Einheit, die Umwelt”, von Uexküll, Jakob Johann u. Krizat, Georg (1934): Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, Berlin: Julius Springer, S. VIII. ↩
-
Nietzsche, Friedrich W. (1873): WL I, in: Ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. v. Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino, Berlin 1988: de Gruyter. Die Nietzschezitation folgt den üblichen Siglen, wobei auf eine Seitenangabe verzichtet und die Abschnittsnummerierung angegeben wird, sodass die Stellen für den Nutzer der ’Digitalen Kritischen Gesamtausgabe’ einfacher zu finden sind. ↩
-
Die University of Melbourne hat diesen Sachverhalt in einem Blogbeitrag unterhaltsam am Beispiel des Koalas veranschaulicht: „If you gather a bunch of Eucalyptus leaves, which the koalas eat, and put them on a plate in front of the koala, the koala won’t know what to do with them; they just sit there and gawk at it. They lack the ability to discern that it’s still food given that the leaves have moved off the tree and onto a new source that they’re unfamiliar with”, Stevens, Chris (2017): Koalas: Not the smartest tool in the shed, https://blogs.unimelb.edu.au/sciencecommunication/2017/09/17/koalas-not-the-smartest-tool-in-the-shed/, Zugriff am 18.03.2021. ↩
-
„Dies noch wünsch’ ich hierbei dir recht zur Kenntnis zu bringen:
Wenn sich die Körper im Leeren mit senkrechtem Falle bewegen,
Durch ihr eigen Gewicht, so werden sie wohl in der Regel
Irgendwo und wann ein wenig zur Seite getrieben,
Doch nur so, daß man sprechen kann von geänderter Richtung.
Wichen sie nicht so ab, dann würden wie Tropfen des Regens
Gradaus alle hinab in die Tiefen des Leeren versinken.
Keine Begegnung und Stoß erführen alsdann die Atome,
Niemals hätte daher die Natur mit der Schöpfung begonnen.”
Lukrez: Über die Natur der Dinge, übers. v. Diels, Hermann, Berlin 1957: Aufbau, S. 67. ↩ -
Nietzsche, Friedrich W. (1887): GM II, 16, in: Ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. v. Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino, Berlin 1988: de Gruyter. ↩
-
Deleuze, Gilles u. Guattari, Felix (1972): Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I, Frankfurt am Main 1974: Suhrkamp, S. 10. ↩
-
Ebd., S. 11. Wir fokussieren uns hier auf menschliche Seite der Gleichung, da wir zu diesem Zeitpunkt nicht daran interessiert sind, unsere Spekulationen auf eine Metaphysik der Natur auszuweiten, wie es die Autoren tun, wenn sie die Identität von Mensch und Natur in der ”universellen Primärproduktion” schizophrener Wunschmaschinen behaupten, vgl. ebd., S. 10 f. Uns scheint, um einen kurzen Abriss der Kritik zu liefern, die hier u. E. ansetzen müsste, die Versetzung dieser Identität an den Anfang, als ontologisches Fundament, Gefahr zu laufen, das utopische Potenzial, das in der Vorstellung einer historisch zu verwirklichenden Versöhnung von Mensch und Natur liegt, zu verdecken. Hier droht die antidialektische Grundhaltung, die das Projekt von Deleuze und Guattari auszeichnet, regressive Züge anzunehmen und sich in den Idealismus zu verwandeln, den sie gerade zu überwinden sucht. ↩
-
Ebd., S. 14. ↩
-
Ebd. ↩
-
Vgl. ebd. ↩
-
Was nicht bedeutet, dass sie der Selbsterhaltung notwendig feindlich gegenübersteht; die Organmaschinen sind, wie auch Deleuze und Guattari betonen, die „working machine”, die die Existenz des ‚organlosen Körpers’ bedingt, vgl. Deleuze, Gilles u. Guattari, Felix (1972): Anti-Ödipus, S. 14. Die Indifferenz gegenüber der Selbsterhaltung, die im Extremfall eine Situation schaffen kann, in der diese gänzlich übergangen und der Organismus gefährdet wird, ist vielmehr das bestimmende Moment der psychischen Triebenergie. ↩
-
Prigogine, Ilya u. Stengers, Isabelle (1984): Order out of Chaos. Man’s New Dialogue with Nature, New York 2017: Verso, S. 12 f. ↩
-
Laplanche, Jean (2017): Eine Metapsychologie - von der Angst auf die Probe gestellt?, in: Ders.: Die allgemeine Verführungstheorie und andere Aufsätze, Frankfurt am Main: Brandes & Apsel, S. 47. ↩
-
Ebd., S. 48. ↩
